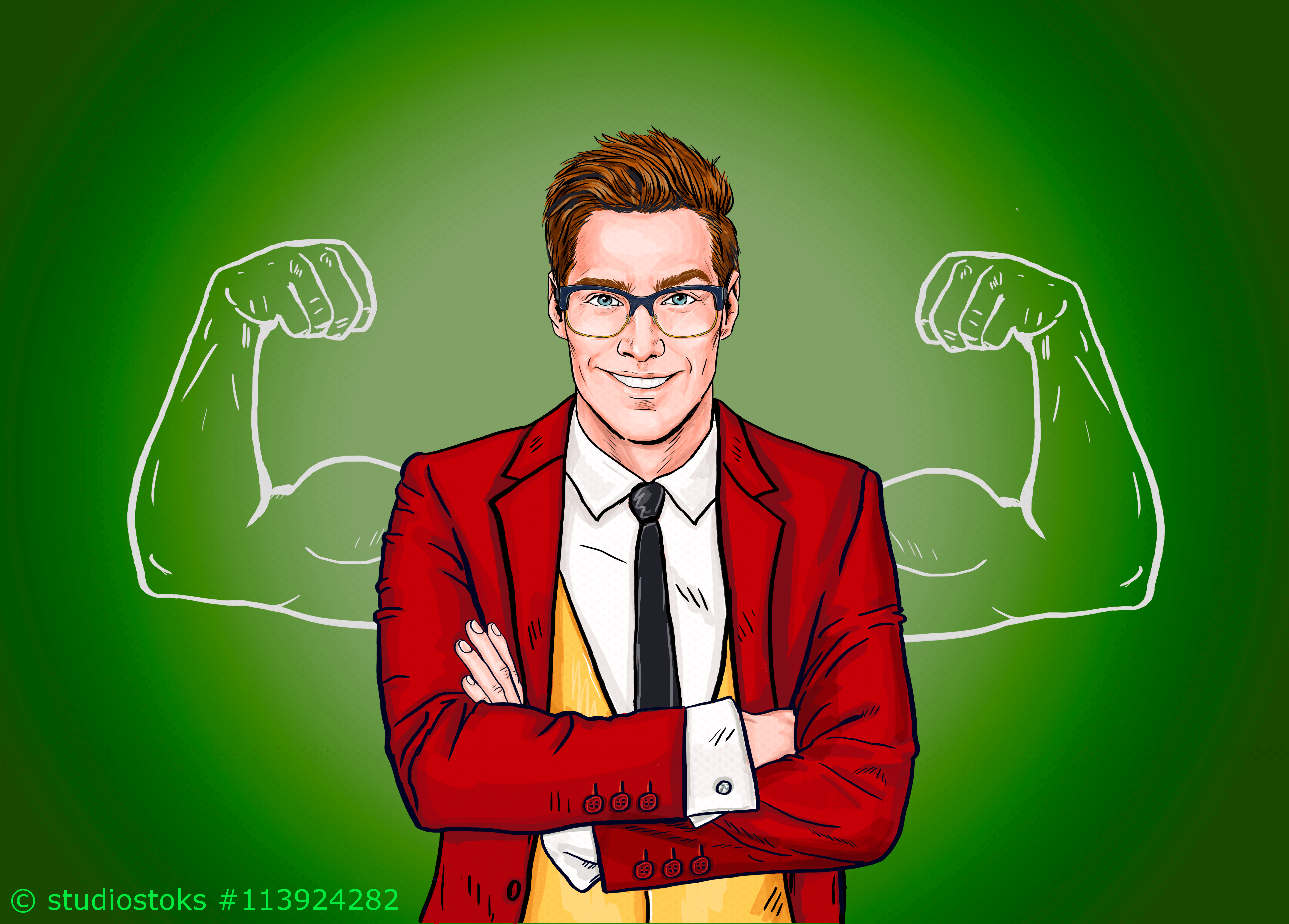So vermeiden Unternehmen KI-Inkompetenz
Veröffentlicht:25. August 2025
So vermeiden Unternehmen KI-Inkompetenz
Auch wenn keine direkten Strafen bei Nichterfüllung bestehen, ist die in der KI-Verordnung geforderte Kompetenz im Umgang mit Künstlicher Intelligenz eine verbindliche Anforderung. Seit dem 2. Februar 2025 sind Unternehmen gemäß Artikel 4 der KI-Verordnung verpflichtet, sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden und externen Beteiligten, die mit KI-Systemen arbeiten, über ausreichende Kenntnisse verfügen. Dies gilt sowohl für Unternehmen, die KI intern einsetzen, als auch für Hersteller, die KI-Systeme oder generative Modelle auf dem europäischen Markt anbieten.
Die Pflicht umfasst gezielte Schulungen über Funktionsweisen, Chancen, Risiken, rechtliche Anforderungen und ethische Standards. Unternehmen müssen dabei Eigenverantwortung übernehmen, da konkrete Vorgaben fehlen. Der europäische Gesetzgeber überlässt den Unternehmen die Ausgestaltung, fordert aber nachdrücklich ein angemessenes Bildungsniveau für alle Beteiligten.
KI-Kompetenz bedeutet ein Zusammenspiel aus Fähigkeiten, Wissen und Verständnis, die es ermöglichen, Systeme sachkundig einzusetzen und mögliche Schäden sowie Risiken zu erkennen. In welcher Tiefe dies erfüllt werden muss, hängt von der jeweiligen Tätigkeit, vorhandenen Vorkenntnissen und vom Risikograd der eingesetzten Systeme ab. Der risikobasierte Ansatz wird zwar nicht ausdrücklich in Artikel 4 genannt, ist aber hineinzuinterpretieren. Systeme mit Hochrisikopotenzial wie KI-Anwendungen im Recruiting erfordern ein deutlich umfangreicheres Verständnis als der Einsatz einfacher KI-Tools für Sprachassistenz oder Textbearbeitung.
Die Vermittlung von Wissen erfolgt in Schulungen vor Ort, über Online-Kurse oder E-Learning-Angebote. Wichtig ist, dass sich die Inhalte auf die tatsächlich verwendeten Systeme und deren spezifische Risiken beziehen. Parallel sollten Unternehmen interne Richtlinien erstellen, die den Umgang mit KI regeln. Eine Acceptable Use Policy kann beispielsweise festlegen, dass bestimmte Anwendungen nur unter klaren Bedingungen genutzt werden dürfen, etwa wenn keine sensiblen Daten verarbeitet werden.
Obwohl Verstöße gegen Artikel 4 nicht direkt zu Bußgeldern führen, hat mangelnde Kompetenz Auswirkungen auf andere Bereiche. Bei Verstößen gegen weitere Vorschriften der KI-Verordnung wird die fehlende Schulung zu einem erschwerenden Faktor. Auch Gerichte können im Schadensfall eine unzureichende Qualifizierung bei der Beurteilung von Sorgfalt oder Verschulden berücksichtigen.
Darüber hinaus ergeben sich Pflichten aus dem Arbeitsschutzgesetz. Unternehmen müssen Gefährdungen neuer Technologien prüfen, Beschäftigte unterweisen und für deren Sicherheit sorgen. Fehlende Schulungen können daher auch hier zu Maßnahmen der Aufsichtsbehörden und Geldbußen bis zu 30.000 Euro führen.
Die Sicherstellung von KI-Kompetenz ist keine theoretische Pflicht, sondern ein zentraler Compliance-Faktor. Unternehmen sind gefordert, klare Lernpfade, dokumentierte Schulungen und kontinuierliche Evaluierungen zu etablieren. Bei Hochrisiko-Systemen ist eine nachweisbare, rollenbasierte Wissensvermittlung unerlässlich.
Neben der Rechtssicherheit bietet ein strukturierter Kompetenzaufbau weitere Vorteile. Mitarbeitende entwickeln durch Wissen weniger Ängste, gehen souveräner mit Technologie um und erzielen bessere Ergebnisse im Einsatz. So wird KI-Kompetenz nicht nur zu einem Schutzinstrument, sondern zu einer strategischen Investition in die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.
Den Originaltext lesen sie hier: So vermeiden Sie KI-Inkompetenz im Unternehmen | CIO DE
So vermeiden Unternehmen KI-Inkompetenz
Veröffentlicht:25. August 2025
So vermeiden Unternehmen KI-Inkompetenz
Auch wenn keine direkten Strafen bei Nichterfüllung bestehen, ist die in der KI-Verordnung geforderte Kompetenz im Umgang mit Künstlicher Intelligenz eine verbindliche Anforderung. Seit dem 2. Februar 2025 sind Unternehmen gemäß Artikel 4 der KI-Verordnung verpflichtet, sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden und externen Beteiligten, die mit KI-Systemen arbeiten, über ausreichende Kenntnisse verfügen. Dies gilt sowohl für Unternehmen, die KI intern einsetzen, als auch für Hersteller, die KI-Systeme oder generative Modelle auf dem europäischen Markt anbieten.
Die Pflicht umfasst gezielte Schulungen über Funktionsweisen, Chancen, Risiken, rechtliche Anforderungen und ethische Standards. Unternehmen müssen dabei Eigenverantwortung übernehmen, da konkrete Vorgaben fehlen. Der europäische Gesetzgeber überlässt den Unternehmen die Ausgestaltung, fordert aber nachdrücklich ein angemessenes Bildungsniveau für alle Beteiligten.
KI-Kompetenz bedeutet ein Zusammenspiel aus Fähigkeiten, Wissen und Verständnis, die es ermöglichen, Systeme sachkundig einzusetzen und mögliche Schäden sowie Risiken zu erkennen. In welcher Tiefe dies erfüllt werden muss, hängt von der jeweiligen Tätigkeit, vorhandenen Vorkenntnissen und vom Risikograd der eingesetzten Systeme ab. Der risikobasierte Ansatz wird zwar nicht ausdrücklich in Artikel 4 genannt, ist aber hineinzuinterpretieren. Systeme mit Hochrisikopotenzial wie KI-Anwendungen im Recruiting erfordern ein deutlich umfangreicheres Verständnis als der Einsatz einfacher KI-Tools für Sprachassistenz oder Textbearbeitung.
Die Vermittlung von Wissen erfolgt in Schulungen vor Ort, über Online-Kurse oder E-Learning-Angebote. Wichtig ist, dass sich die Inhalte auf die tatsächlich verwendeten Systeme und deren spezifische Risiken beziehen. Parallel sollten Unternehmen interne Richtlinien erstellen, die den Umgang mit KI regeln. Eine Acceptable Use Policy kann beispielsweise festlegen, dass bestimmte Anwendungen nur unter klaren Bedingungen genutzt werden dürfen, etwa wenn keine sensiblen Daten verarbeitet werden.
Obwohl Verstöße gegen Artikel 4 nicht direkt zu Bußgeldern führen, hat mangelnde Kompetenz Auswirkungen auf andere Bereiche. Bei Verstößen gegen weitere Vorschriften der KI-Verordnung wird die fehlende Schulung zu einem erschwerenden Faktor. Auch Gerichte können im Schadensfall eine unzureichende Qualifizierung bei der Beurteilung von Sorgfalt oder Verschulden berücksichtigen.
Darüber hinaus ergeben sich Pflichten aus dem Arbeitsschutzgesetz. Unternehmen müssen Gefährdungen neuer Technologien prüfen, Beschäftigte unterweisen und für deren Sicherheit sorgen. Fehlende Schulungen können daher auch hier zu Maßnahmen der Aufsichtsbehörden und Geldbußen bis zu 30.000 Euro führen.
Die Sicherstellung von KI-Kompetenz ist keine theoretische Pflicht, sondern ein zentraler Compliance-Faktor. Unternehmen sind gefordert, klare Lernpfade, dokumentierte Schulungen und kontinuierliche Evaluierungen zu etablieren. Bei Hochrisiko-Systemen ist eine nachweisbare, rollenbasierte Wissensvermittlung unerlässlich.
Neben der Rechtssicherheit bietet ein strukturierter Kompetenzaufbau weitere Vorteile. Mitarbeitende entwickeln durch Wissen weniger Ängste, gehen souveräner mit Technologie um und erzielen bessere Ergebnisse im Einsatz. So wird KI-Kompetenz nicht nur zu einem Schutzinstrument, sondern zu einer strategischen Investition in die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.
Den Originaltext lesen sie hier: So vermeiden Sie KI-Inkompetenz im Unternehmen | CIO DE