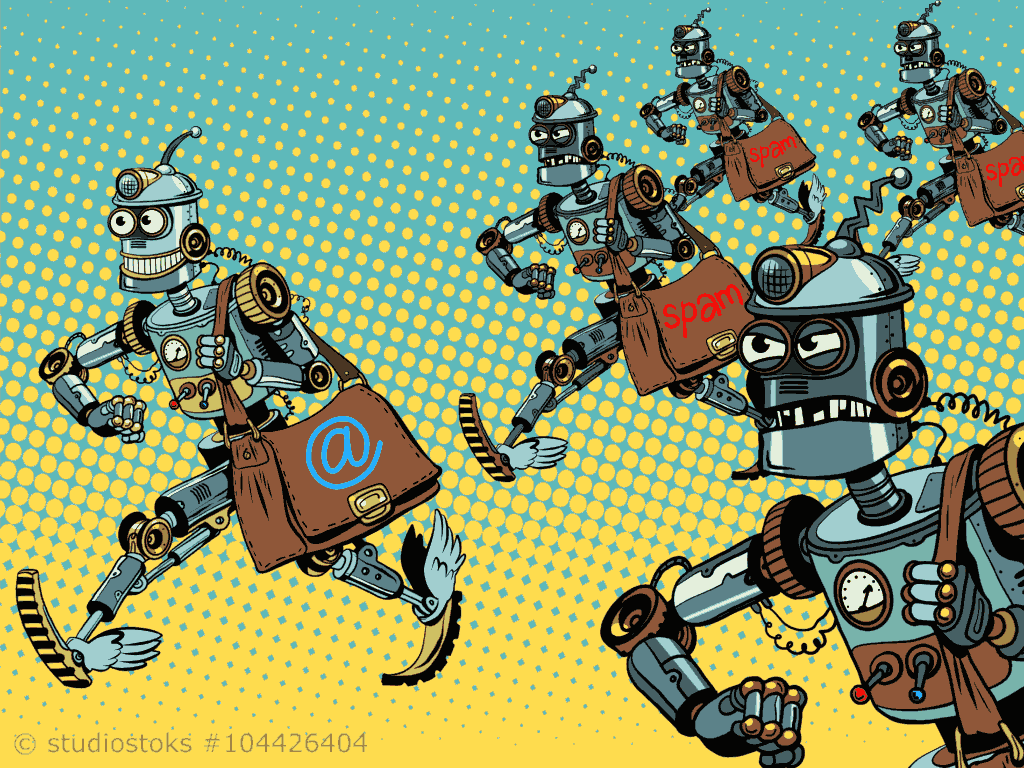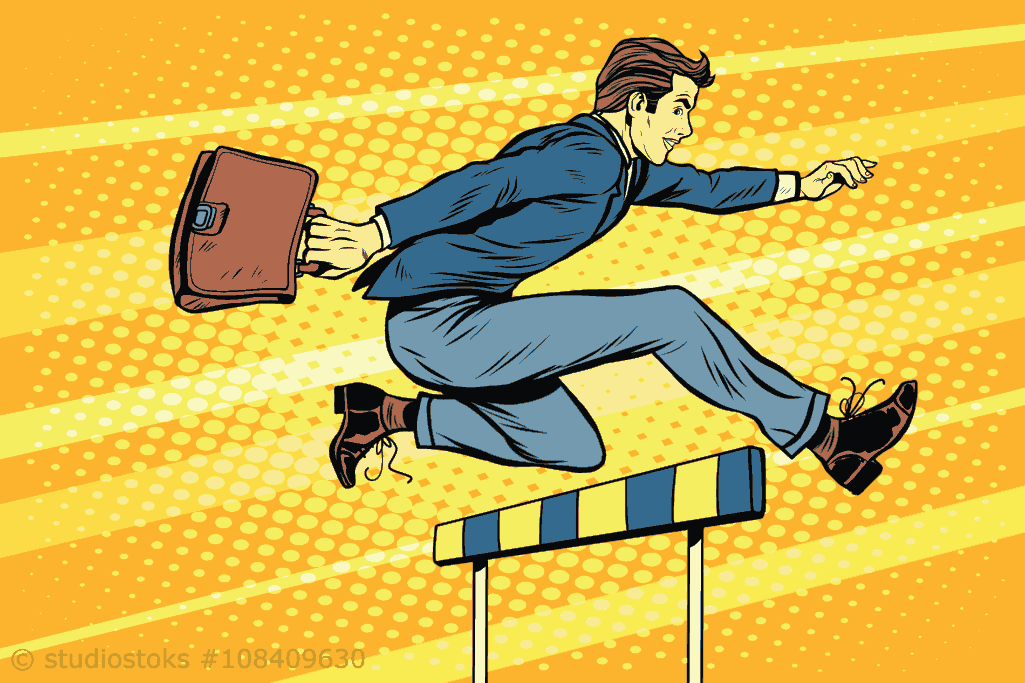Schenkungsteuer beim Unternehmenskauf vermeiden
Veröffentlicht:29. September 2025
Schenkungsteuer beim Unternehmenskauf vermeiden
Wenn ein Haus, ein Unternehmen oder ein Maklerbestand den Besitzer wechselt, dann schwingt bei solchen großen Geschäften stets die Möglichkeit mit, dass das Finanzamt die Hand aufhält und Schenkungsteuer verlangt. Auf den ersten Blick klingt das merkwürdig, schließlich handelt es sich doch um einen Kauf und nicht um eine Schenkung. Doch die Steuerproblematik entsteht immer dann, wenn der vereinbarte Kaufpreis spürbar niedriger liegt als der Wert, den das Finanzamt oder ein unabhängiger Gutachter für das Objekt ansetzen würde. In diesem Fall betrachtet die Behörde die Differenz als Geschenk und fordert darauf unter Umständen Schenkungsteuer ein.
Ein klassisches Beispiel ist der Verkauf eines Maklerbestands. Ein Versicherungsmakler tritt in den Ruhestand, er hat finanziell gut vorgesorgt und übergibt seinen mühsam aufgebauten Kundenstamm an einen Kollegen. Anstatt den höchsten denkbaren Preis auszuschlagen, räumt er dem Nachfolger entgegenkommend einen vergleichsweisen günstigen Kaufpreis ein. Der Käufer freut sich über das vermeintliche Schnäppchen, der Verkäufer über die geordnete Übergabe. Doch genau in diesem Moment kann das Finanzamt aufmerksam werden. Denn wenn der gezahlte Kaufpreis zu niedrig ist, gilt der restliche Betrag als unentgeltlich zugewandt, sprich als Geschenk. Und da Käufer und Verkäufer nicht verwandt oder verschwägert sind, beträgt der einschlägige Freibetrag auf die Schenkungsteuer lediglich 20.000 Euro, eine Summe, die in der Geschäftswelt sehr schnell überschritten wird.
Das Problem betrifft nicht nur Bestände von Versicherungsmaklern. Auch Immobilien oder Unternehmensanteile geraten ins Visier der Steuerbehörden, sobald sie unter Wert verkauft werden. Selbst in der Investmentbranche kam es bereits vor, dass Vermögensverwalter beim Ausstieg zu sehr günstigen Konditionen verkauften und den Käufern anschließend Post vom Finanzamt ins Haus flatterte. Die Fallkonstellationen sind zahlreich und die Steuerfalle schnappt auf unterschiedliche Weise zu. Am Ende entscheidet stets die Bewertung durch die Finanzbehörde, die genau prüft, wie hoch der objektive Marktwert zum Zeitpunkt des Verkaufs gewesen wäre.
Zur Orientierung gibt es Erfahrungswerte. Fachleute berichten, dass das Finanzamt unruhig wird, wenn der Kaufpreis mehr als 20 bis 25 Prozent unterhalb des Marktwerts liegt. Ein Prüfer fragt dann: Ist dies ein marktgerechter Preis, den auch fremde Dritte so vereinbart hätten, oder liegt ein sogenanntes verdecktes Geschenk vor? Um diese Frage für sich zu beantworten, greift die Behörde auf das Bewertungsgesetz zurück. Dort ist geregelt, wie ein Unternehmen oder ein Bestand nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren zu bewerten ist. Dabei wird der nachhaltig erzielbare Jahresertrag multipliziert mit einem von der Gesetzgebung festgelegten Kapitalisierungsfaktor, der derzeit 13,75 beträgt. Als Grundlage dient das durchschnittliche Betriebsergebnis der letzten drei Jahre. Dieses Verfahren richtet den Blick stark in die Vergangenheit und neigt dazu, hohe Werte auszuweisen, was für den Käufer riskant sein kann.
Die Preisgestaltung kann somit angemessen sein, obwohl das Finanzamt Zweifel anmeldet. Wer Ärger vermeiden will, sollte den Begriff der Fremdüblichkeit im Kopf behalten. Damit ist gemeint, dass der vereinbarte Kaufpreis so beschaffen sein muss, wie er auch zwischen völlig unabhängigen Beteiligten vereinbart worden wäre. Mit anderen Worten: Er darf nicht nach Gefälligkeit aussehen, sondern muss auf nachvollziehbaren Bewertungsmaßstäben beruhen. Ein professionelles Wertgutachten kann deshalb hierbei entscheidend sein. Wer ein Gutachten eines spezialisierten Instituts vorlegt, zwingt das Finanzamt dazu, dessen Einschätzung zu berücksichtigen und nicht nur schematisch nach dem Ertragswertverfahren zu bewerten.
Zusätzlich lohnt es sich, bei Vertragsgestaltungen kreativ, aber zugleich vorsichtig zu sein. Manche Kaufverträge sehen Zahlungen in mehreren Raten vor, wobei die letzten Raten nur fällig werden, wenn bestimmte Bedingungen eintreten, zum Beispiel ein zuvor vereinbarter Gewinnschwellenwert. Werden diese Ziele nicht erreicht, reduziert sich der Kaufpreis automatisch. Auch das kann dazu führen, dass der Käufer effektiv weniger zahlt, ohne dass es wie eine unzulässige Vergünstigung aussieht. Allerdings warnt die Praxis davor, solche Klauseln missbräuchlich einzusetzen. Denn, sobald die Finanzverwaltung eine Gestaltung als Umgehungstatbestand wertet, steht schnell der schwere Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum.
Am Ende bleiben für Käufer und Verkäufer zwei Wege: Entweder sie gestalten den Kaufpreis transparent, fremdüblich und mit tragfähigen Bewertungen untermauert, oder sie nehmen die Möglichkeit in Kauf, dass ein Teil des Preisvorteils als Schenkung versteuert werden muss. In manchen Konstellationen mag das hinnehmbar sein, denn was man an Schenkungsteuer abführt, mindert umgekehrt die Steuerlast beim Verkäufer, da dessen Einkünfte geringer ausfallen. Im Ergebnis geht es immer darum, wo Finanzamt, Käufer und Verkäufer den wahren Wert eines Geschäfts verorten. Wer frühzeitig mit Gutachten und sauber dokumentierten Verträgen arbeitet, kann die rechtlichen Risiken minimieren und den Übergang von Immobilien, Unternehmen oder Maklerbeständen so gestalten, dass die unerwartete Steuerlast im besten Fall ganz ausbleibt.
Den Originaltext lesen sie hier: Wann und warum beim Bestandskauf Schenkungsteuer fällig wird – Pfefferminzia.de
Schenkungsteuer beim Unternehmenskauf vermeiden
Veröffentlicht:29. September 2025
Schenkungsteuer beim Unternehmenskauf vermeiden
Wenn ein Haus, ein Unternehmen oder ein Maklerbestand den Besitzer wechselt, dann schwingt bei solchen großen Geschäften stets die Möglichkeit mit, dass das Finanzamt die Hand aufhält und Schenkungsteuer verlangt. Auf den ersten Blick klingt das merkwürdig, schließlich handelt es sich doch um einen Kauf und nicht um eine Schenkung. Doch die Steuerproblematik entsteht immer dann, wenn der vereinbarte Kaufpreis spürbar niedriger liegt als der Wert, den das Finanzamt oder ein unabhängiger Gutachter für das Objekt ansetzen würde. In diesem Fall betrachtet die Behörde die Differenz als Geschenk und fordert darauf unter Umständen Schenkungsteuer ein.
Ein klassisches Beispiel ist der Verkauf eines Maklerbestands. Ein Versicherungsmakler tritt in den Ruhestand, er hat finanziell gut vorgesorgt und übergibt seinen mühsam aufgebauten Kundenstamm an einen Kollegen. Anstatt den höchsten denkbaren Preis auszuschlagen, räumt er dem Nachfolger entgegenkommend einen vergleichsweisen günstigen Kaufpreis ein. Der Käufer freut sich über das vermeintliche Schnäppchen, der Verkäufer über die geordnete Übergabe. Doch genau in diesem Moment kann das Finanzamt aufmerksam werden. Denn wenn der gezahlte Kaufpreis zu niedrig ist, gilt der restliche Betrag als unentgeltlich zugewandt, sprich als Geschenk. Und da Käufer und Verkäufer nicht verwandt oder verschwägert sind, beträgt der einschlägige Freibetrag auf die Schenkungsteuer lediglich 20.000 Euro, eine Summe, die in der Geschäftswelt sehr schnell überschritten wird.
Das Problem betrifft nicht nur Bestände von Versicherungsmaklern. Auch Immobilien oder Unternehmensanteile geraten ins Visier der Steuerbehörden, sobald sie unter Wert verkauft werden. Selbst in der Investmentbranche kam es bereits vor, dass Vermögensverwalter beim Ausstieg zu sehr günstigen Konditionen verkauften und den Käufern anschließend Post vom Finanzamt ins Haus flatterte. Die Fallkonstellationen sind zahlreich und die Steuerfalle schnappt auf unterschiedliche Weise zu. Am Ende entscheidet stets die Bewertung durch die Finanzbehörde, die genau prüft, wie hoch der objektive Marktwert zum Zeitpunkt des Verkaufs gewesen wäre.
Zur Orientierung gibt es Erfahrungswerte. Fachleute berichten, dass das Finanzamt unruhig wird, wenn der Kaufpreis mehr als 20 bis 25 Prozent unterhalb des Marktwerts liegt. Ein Prüfer fragt dann: Ist dies ein marktgerechter Preis, den auch fremde Dritte so vereinbart hätten, oder liegt ein sogenanntes verdecktes Geschenk vor? Um diese Frage für sich zu beantworten, greift die Behörde auf das Bewertungsgesetz zurück. Dort ist geregelt, wie ein Unternehmen oder ein Bestand nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren zu bewerten ist. Dabei wird der nachhaltig erzielbare Jahresertrag multipliziert mit einem von der Gesetzgebung festgelegten Kapitalisierungsfaktor, der derzeit 13,75 beträgt. Als Grundlage dient das durchschnittliche Betriebsergebnis der letzten drei Jahre. Dieses Verfahren richtet den Blick stark in die Vergangenheit und neigt dazu, hohe Werte auszuweisen, was für den Käufer riskant sein kann.
Die Preisgestaltung kann somit angemessen sein, obwohl das Finanzamt Zweifel anmeldet. Wer Ärger vermeiden will, sollte den Begriff der Fremdüblichkeit im Kopf behalten. Damit ist gemeint, dass der vereinbarte Kaufpreis so beschaffen sein muss, wie er auch zwischen völlig unabhängigen Beteiligten vereinbart worden wäre. Mit anderen Worten: Er darf nicht nach Gefälligkeit aussehen, sondern muss auf nachvollziehbaren Bewertungsmaßstäben beruhen. Ein professionelles Wertgutachten kann deshalb hierbei entscheidend sein. Wer ein Gutachten eines spezialisierten Instituts vorlegt, zwingt das Finanzamt dazu, dessen Einschätzung zu berücksichtigen und nicht nur schematisch nach dem Ertragswertverfahren zu bewerten.
Zusätzlich lohnt es sich, bei Vertragsgestaltungen kreativ, aber zugleich vorsichtig zu sein. Manche Kaufverträge sehen Zahlungen in mehreren Raten vor, wobei die letzten Raten nur fällig werden, wenn bestimmte Bedingungen eintreten, zum Beispiel ein zuvor vereinbarter Gewinnschwellenwert. Werden diese Ziele nicht erreicht, reduziert sich der Kaufpreis automatisch. Auch das kann dazu führen, dass der Käufer effektiv weniger zahlt, ohne dass es wie eine unzulässige Vergünstigung aussieht. Allerdings warnt die Praxis davor, solche Klauseln missbräuchlich einzusetzen. Denn, sobald die Finanzverwaltung eine Gestaltung als Umgehungstatbestand wertet, steht schnell der schwere Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum.
Am Ende bleiben für Käufer und Verkäufer zwei Wege: Entweder sie gestalten den Kaufpreis transparent, fremdüblich und mit tragfähigen Bewertungen untermauert, oder sie nehmen die Möglichkeit in Kauf, dass ein Teil des Preisvorteils als Schenkung versteuert werden muss. In manchen Konstellationen mag das hinnehmbar sein, denn was man an Schenkungsteuer abführt, mindert umgekehrt die Steuerlast beim Verkäufer, da dessen Einkünfte geringer ausfallen. Im Ergebnis geht es immer darum, wo Finanzamt, Käufer und Verkäufer den wahren Wert eines Geschäfts verorten. Wer frühzeitig mit Gutachten und sauber dokumentierten Verträgen arbeitet, kann die rechtlichen Risiken minimieren und den Übergang von Immobilien, Unternehmen oder Maklerbeständen so gestalten, dass die unerwartete Steuerlast im besten Fall ganz ausbleibt.
Den Originaltext lesen sie hier: Wann und warum beim Bestandskauf Schenkungsteuer fällig wird – Pfefferminzia.de